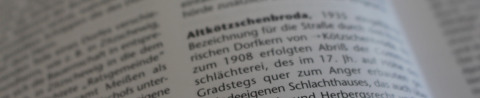Käthe Kollwitz
"Ich bin aus der Wahrheit der fünf Sinne" Erinnerung an Käthe Kollwitz zum 150. Geburtstag
Radikal, treffsicher realistisch und dennoch poetisch damit lässt sich der Stil von Käthe Kollwitz beschreiben, der sie zu einer Berühmtheit künstlerisch tätiger Frauen des 20. Jahrhunderts avancieren ließ. Ihre schöpferische Bandbreite umfasst Grafik, Malerei und Bildhauerei. In mehr als 64 Jahren entstanden eine Vielzahl Lithografien, Holzschnitte, Radierungen, Kupferstiche und Plastiken. Jedes Motiv verwebte sich dabei mit eigenen Lebensbereichen und -erinnerungen. Aber auch Strömungen, wie beispielsweise die Motivreduktion vom Expressionismus oder die sachliche Aneignung der Wirklichkeit beim Realismus, fanden Eingang in ihre Kunst.
Am 8. Juli 1867 wurde sie in Königsberg (heutiges Kaliningrad) geboren, wo sie bis zu ihrem 18. Geburtstag lebte. Bereits früh entdeckte der Vater Karl Schmidt (1825-1898) ihr Talent und förderte es konsequent. Da er ein liberaler Verfechter von Freiheit war und sich an der 1848er Revolution beteiligte, blieb ihm eine Anstellung als studierter Jurist beim Preußischen Staat verwehrt. Kurzerhand sattelte er auf das Maurerhandwerk um und stieg darin bis zum Meister auf. Überdies war er in einer freireligiösen Gemeinde als Pfarrervikar tätig. Schon im väterlichen Betrieb lernte Käthe das Modellieren lieben. Anregungen fand sie dazu in der nahen Eisengießerei. Von der Mutter erbte Käthe wohl den Hang zum Zeichnen. Es war ein sehr geistiges und belesenes, wie auch künstlerisch verständiges Elternhaus. Mit 14 Jahren erhielt sie daher Zeichenunterricht. Zwar hatte sie freien Zugang zu hochintellektueller Literatur, philosophischen Texten und Kunstbüchern, doch blieb ihr dieser hinsichtlich eines akademischen Studiums als Frau verwehrt. Einen Kompromiss stellte für die 17jährige eine Einschreibung in die Berliner Damenakademie dar, welche vom „Verein der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen“ gegründet wurde. In der Hauptstadt lernte sie zudem bekannte Dichter und Bildner kennen, von denen sie sowohl thematisch als auch stilistisch stark beeinflusst wurde. Abgerundet wurde ihr künstlerischer Bildungsweg vom Unterricht an den Kunstakademien in München und Königsberg. Hier heiratete sie 1891 den Arzt Dr. Karl Kollwitz (1863-1940). Zusammen ließen sie sich in einem Berliner Arbeiterbezirk nieder (späterer Ortsteil Prenzlauer Berg), wo er eine Praxis für Allgemeinmedizin eröffnete. Das soziale Engagement sowie den Fokus auf das Arbeitermilieu hatte er mit seiner Gattin gemein, denn er verpflichtete sich als Armenarzt. Der Erstgeborene Hans Kollwitz (1892-1971) folgte den beruflichen Fußstapfen seines Vaters, der andere Sohn Peter (*1896) fiel bereits 1914. Dieser einschneidende Verlust verstärkte die pazifistische und sozialistische Lebenseinstellung von Käthe Kollwitz. Sie stand mit ihrer Kunst dafür ein, die realen sozialen Umstände abzubilden.
Ein Studienaufenthalt in Paris 1904 formte ihr schöpferisches Können weiter aus. Es wurde immer vielgestaltiger und die Künstlerin erfolgreicher, was sich bereits früh in Auszeichnungen niederschlug. Damit steigerten sich auch die Preise für ihre Blätter, was ihr jedoch nicht unbedingt behagte, da sich Normalbürger und Arbeiter, die ja ihr Sujet waren, die Werke kaum noch leisten konnten. Sie stellte wachen Auges den Not leidenden Menschen mit großem Herz, Würde und berührender Zuneigung dar. Nie erhob sie sich spöttisch über die individuelle Kümmernis. Motive fand sie allerorten im zwiespältigen Armeleuteberlin, oft zeichnete sie im Obdachlosenasyl, von denen es tausende gab, oder auch im Frauengefängnis. Den Schmerz einer Mutter, deren Sohn im Feld geblieben ist, kannte sie selber. So schuf sie später eine Bildfolge zum Thema Krieg („Saatfrüchte dürfen nicht vermahlen werden“). 1898 hatte sie mit der Radierserie „Ein Weberaufstand“ bei der Großen Berliner Kunstausstellung beachtliche Lorbeeren erworben. Jetzt berief man sie als Lehrerin an die Damenakademie, wo sie einst selbst gelernt hatte und fünf Jahre lang dozierte. Gleichzeitig wurde ihr die Verleihung einer Kunst-Medaille durch Kaiser Wilhelm II. verweigert, der ihre moderne gestalterische Ausdrucksweise als „Rinnsteinkunst“ abtat. Doch schon 1906 erhielt sie den Villa-Romana-Preis. Es ist der inzwischen älteste deutsche Kunstpreis. Viele weitere Ehrungen folgten: z.B. 1919 die Ernennung der Preußischen Akademie der Künste als erste weibliche Professorin, später übernahm sie die Leitung der Meisterklasse; oder die Prämierung als erste Frau mit dem preußischen Meriten-Orden für Wissenschaften und Künste 1929. Doch trotz aller Huldigungen bekennt sie, dass ihr großes Aufheben um ihre Person stets äußerst unbeliebt war.
Der Erste Weltkrieg hatte ihr den Sohn Peter genommen, der Zweite den nach ihm benannten Enkel, sowie ihr eigenes Heim. Sämtliche Grafiken, Drucke und Druckplatten fielen 1943 dem Bombenangriff zum Opfer. Sie selbst entkam, flüchtete zur befreundeten Bildhauerin nach Nordhausen und zog auf Vermittlung vom Kunstliebhaber Prinz Ernst Heinrich von Sachsen nach Moritzburg, wo sie zwei Zimmer auf dem Rüdenhof bezog. Die beiden Gräfinnen zu Münster gingen damit 1944 ein persönliches Risiko ein, denn Käthe Kollwitz war inzwischen von den Nazis schmählich geächtet worden. Doch ihrer christlichen Gesinnung folgend war dies ein Gebot der Menschlichkeit. 1945 wurden sie enteignet und ihrerseits zur Flucht gezwungen. Heute gedenkt ein Museum an das schöpferische Lebenswerk der Künstlerin, überdies mit einer gegenwärtigen Sonderausstellung zum Geburtsjubiläum. Käthe Kollwitz verbrachte dort einige Monate. Der Blick auf das Schloss ließ sie noch einmal kurz in Hoffnung aufleben. Am 22. April 1945 ist sie gegangen und fand neben ihrem Mann im Berliner Familiengrab ihren ewigen Ruheplatz. Der letzte Tagebucheintrag lautete: „Aber einmal wird ein neues Ideal erstehen, und es wird mit allem Krieg zu Ende sein In dieser Überzeugung sterbe ich. Man wird hart dafür arbeiten müssen, aber man wird es erreichen.“
Bei der gravierenden Aktualität dieser Worte läuft es einem kalt den Rücken hinunter und man muss sich fragen, ob sich manche Leute von dieser Arbeit bereits abgewandt haben.
Maren Gündel, Stadtarchiv
Erschienen in: Amtsblatt Radebeul, Juni 2017